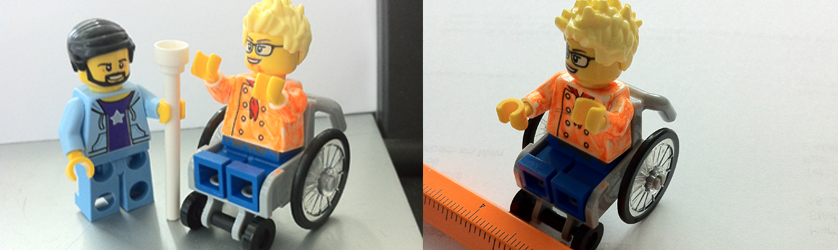Medizinisches
"Forschung zur tödlichen Muskelschwäche"
(AP). Hoffnung im Kampf gegen eine tödliche angeborene Muskelschwäche könnte in einer Therapie mit Hilfe von Stammzellen liegen. Wissenschaftler der Universität Bonn und des Kinderkrankenhauses von Pittsburgh, USA, haben nach Angaben der Universität bei Mäusen spezielle Stammzellen isoliert, die die Regeneration der von Muskeldystrophie geschädigten Zellen verbessern können. Die von Wissenschaftlern um den US-Forscher Johnny Huard und den Bonner Physiologen Anton Wernig entdeckten Stammzellen wecken Hoffnung auf effektivere Therapien degenerativer Muskelerkrankungen wie der Duchenne`schen Muskeldystrophie. „Wir sollten diese Befunde jedoch nicht überbewerten“, warnte Wernig. Der in der Maus gefundene Zelltypus wurde beim Menschen bislang noch nicht nachgewiesen. Im Rahmen eines EU Projekts würden Untersuchungen durchgeführt. An Muskeldystrophie erkranken fast ausschließlich Männer; auf Grund eines Gendefekts fehlen wichtige Eiweiße für den Muskelstoffwechsel. Einer von 3000 männlichen Neugeborenen leidet an der unheilbaren Erbkrankheit; der Krankheitsverlauf lässt sich durch Krankengymnastik und Medikamenten nur verzögern. Das Muskelgewebe wird abgebaut, so dass die Kinder meist schon vor dem zehnten Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen sind. Schließlich werden auch Atem- und Herzmuskulatur in Leidenschaft gezogen; die Patienten versterben an Herzversagen oder Atemnot.“
Quelle: Wetterauer Zeitung vom 09.07.2002
end #post-##
Stammzellen gegen Gifte gewappnet
end .entry-meta
Washington. Stammzellen verhalten sich immer so, als ob sie unter Stress stehen würden. Das fanden amerikanische Wissenschaftler heraus. So bilden die Zellen große Mengen an Proteinen für die DNA-Reparatur, die Zerstörung von Giften und den Auf- und Abbau anderer Proteine. Dadurch würden Fehler bei der Weitergabe der Erbinformationen vermieden, die bei einer Stammzelle als „Urmutter“ Millionen ausdifferenzierter Zellen für den Körper besonders gefährlich wären. Zudem werden die Stammzellen von den Stress-Proteinen vor Alterungsprozessen geschützt.
Das Team um Douglas A. Melton von der Harvard University in Cambridge (US- Staat Massachusetts) verglich aber vor allem die Gen-Aktivität von Zellen. Ergebnis: Die Aktivität der Nerven-Stammzellen ähnelt derjenigen embryonaler Stammzellen. Diese Entdeckung stärkt nach Ansicht der Forscher die Hoffnung, mit Hilfe embryonaler Stammzellen Krankheiten behandeln zu können, bei denen Nervenzellen zerstört werden. Die Analyse von 1800 Mäuse-Genen habe gezeigt, dass mehr als 61 Prozent dieser Erbinformationen sowohl in neuronalen als auch in embryonalen Stammzellen abgelesen würden
Damit gleicht die Gen-Aktivität neuronaler Stammzellen der ihrer embryonalen Verwandten deutlich stärker als der ausgereifter Nervenzellen.
Quelle: Taunus Zeitung vom 14.09.2002
end #post-##
end .entry-meta
Madison. Forscher haben erstmals gezielt ein Krankheitsgen in embryonalen Stammzellen von Menschen ausgeschaltet. Dieser Vorgang sei bisher nur bei Mäusen möglich gewesen, sagte eine Sprecherin der Universität von Wisconsin. Embryonale Stammzellen sind der Grundstock, aus dem sich alle 220 verschiedenen Zellarten im Körper entwickeln. Manche Mediziner hoffen, sie einmal zur Gewinnung von Ersatzorganen und -gewebe nutzen zu können.
„Das ist schon ein Durchbruch für die Forschung“, sagt Wolfgang-Michael Franz vom Universitätsklinikum Großhadern. „Die Technik ermöglicht im Reagenzglas an einzelnen Zellen gezielt Gene auszuschalten.“ Dank der Arbeit des aus Deutschland stammenden Forschers Thomas Zwaka und des US-Forschers James Thomson könnten Wissenschaftler nun eine genetisch bedingte Krankheit direkt an menschlichen embryonalen Stammzellen studieren. Bislang seien solche Arbeiten vor allem mit Knockout-Mäusen gemacht worden, bei den Tieren waren ebenfalls spezielle Gene ausgeschaltet worden. Wichtig sei das neue Verfahren unter anderem bei Herzkrankheiten, weil viele Störungen dabei nicht an Mäusen erforscht werden können, sagt Franz.
Zwaka (30) und seine Kollegen von der Universität von Wisconsin hoffen, künftig Insulin produzierende Stammzellen für Diabetiker oder Dopamin produzierende Stammzellen für Parkinson-Kranke herstellen zu können. Die Technik mache möglicherweise auch einmal die bisher wenig erfolgreichen Methoden der Gentherapien überflüssig, sagt Zwaka.
Quelle: Taunus Zeitung vom 12.02.2003
end #post-##
Neuro-Chip analysiert Nervengewebe
end .entry-meta
München. Der Siliziumchip vereint 16 384 empfindliche Sensoren auf einem Quadratmillimeter. Und mit seiner Hilfe können Forscher beobachten, wie sich lebende Nervenzellen miteinander verständigen. Der Neuro-Chip, eine Gemeinschaftsentwicklung des Max-Planck-Instituts für Biochemie und des Chipherstellers Infineon, mache die Analyse der elektrischen Nervensignale mit bislang unerreichter Genauigkeit möglich, heißt es. Von Versuchen mit dem Chip und Nervengewebe von Tieren erhoffen sich die Forscher unter anderem neue Testmöglichkeiten für Medikamente und detaillierte Karten des Gehirns.
Nervenzellen können direkt auf dem Chip am Leben gehalten werden und dort zu neuronalen Netzen zusammenwachsen. So können Forscher das Nervengewebe über Wochen störungsfrei untersuchen und damit Einblick in die Funktionsweise von Lernvorgängen und anderen Abläufen im Gehirn gewinnen, sagt Peter Fromherz vom Max-Planck-Institut für Biochemie. „Wir hoffen zu lernen, wie so ein Stück Hirn funktioniert.“
Die Sensoren auf dem Neuro-Chip liegen mit achttausendstel Millimetern Abstand so dicht beieinander, dass jede der zehn bis 50-tausendstel Millimeter dicken Nervenzellen mindestens auf einem Sensor liegt. Pro Sekunde zeichnet jeder Sensor mehr als 2000 Einzelwerte auf. Der zeitliche Verlauf dieser Daten lasse sich als Karte der elektrischen Ströme im Nervengewebe darstellen. So könne man sehen, wie ganze Zellverbände auf elektrische Stimulation oder auf bestimmte Substanzen reagieren.
Quelle: Taunus Zeitung vom 12.02.2003
end #post-##
Forscher: Schmerztherapie durch Autohypnose?
end .entry-meta
Mit Hilfe einer neuen Schmerztherapie mittels Hypnose sollen Patienten ihre Leiden lindern können. Unter Anleitung eines Therapeuten lernen Schmerzpatienten, sich durch einen auf Kassette gesprochenen Text in einen Zustand tiefer Entspannung zu versetzen, teilt die Universität Göttingen mit, an der die neue Methode entwickelt wurde. Mit der individuell abgestimmten Autohypnose gelingt es den Untersuchungen zufolge, Schmerzen deutlich zu reduzieren, die mit der Krankheit einhergehenden Depressionen zu lindern und dadurch den Alltag der Patienten zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu verbessern.
Die Therapie soll 15 Millionen Patienten mit chronischen Schmerzen helfen. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitstudie am Göttinger Psychologie-Institut erprobten 14 Patienten das verhaltenstherapeutische Kurzprogramm. In zwei Vorbereitungsstunden und neun Sitzungen erlernten sie die hypnotischen Interventionen, führten Schmerztagebücher und durchliefen mehrere Tests. Alle Patienten zeigten den Angaben zufolge eine schwere Symptomatik und galten als „austherapiert“ – es gab medizinisch keine Möglichkeiten mehr, ihre Schmerzen zu lindern. Die zehn weiblichen und vier männlichen Teilnehmer litten unter Rückenschmerzen, Migräne oder Rheuma.
„Das Ergebnis der Studie zeigte eine deutliche Reduktion der Schmerzstärke und ähnlich starke Verbesserungen in den Bereichen Depressivität und Funktionsfähigkeit“, sagt der Göttinger Wissenschaftler Stefan Jacobs. Wer zu Hause mindestens zwei Mal am Tag seine persönliche Fantasiereise praktizierte, profitierte dauerhaft, wie eine Nachuntersuchung nach drei Monaten zeigte. Damit niedergelassene Therapeuten das Therapieprogramm ihren Patienten anbieten können, haben die Göttinger Psychologen ein Lehrvideo und eine Therapieanleitung entwickelt.
Quelle: Taunus Zeitung vom 21.02.2003
end #post-##
Nervenzellen kommunizieren mit dem Computer
end .entry-meta
Ein neuer Bio-Sensorchip ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen lebenden Nervenzellen und dem Computer. Der so genannte Neuro-Chip, den der Halbleiterhersteller Infineon gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut entwickelt hat, nimmt elektrische Signale von tierischen Hirnzellen auf und leitet sie an einen Rechner weiter. Laut Roland Thewes von der Infineon-Grundlagenforschung lässt sich so die Funktionsweise von Hirnzellen analysieren – etwa die Frage, wie Informationen im Gedächtnis gespeichert werden.
Auf dem fünf mal sechs Millimeter großen Neuro-Chip sind pro Quadratmillimeter rund 16 400 Sensoren angebracht, die die extrem schwachen Signale der Neuronen verstärken und verarbeiten. „Jede Nervenzelle liegt dabei auf mindestens einem Sensor“, so Thewes. Der Abstand zwischen den Sensoren beträgt acht Tausendstel Millimeter und ist damit kleiner als der Durchmesser eines Neurons, der zwischen zehn und 50 Tausendstel Millimetern liegt. Jeder Sensor kann mehr als 2000 Werte pro Sekunde aufzeichnen. Durch die Messungen werden die Nervenzellen nicht verletzt, wie Thewes weiter erläutert. Auf dem Sensorfeld blieben die einzelnen Neuronen nicht nur am Leben, sondern könnten auch wieder zu Netzen zusammenwachsen. Die Gehirnzellen stammen dem Ingenieur zufolge von bestimmten Schneckenarten und Ratten. Mithilfe der Daten können Neurobiologen analysieren, wie einzelne Zellen oder ganze Zellverbände auf Stimulation oder auf bestimmte Substanzen reagieren. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über den Neuronen-Dschungel im menschlichen Gehirn, wo mehr als 100 Milliarden Nervenzellen ständig Informationen austauschen. So könnten vielleicht unheilbare Hirnkrankheiten wie Alzheimer enträtselt werden. Auch die Analyse von kranken Herzmuskelzellen oder von Krebstumor-Zellen sei vorstellbar, sagt Thewes. Bei der Entwicklung von Medikamenten könnten mit Hilfe des Chips genaue Wirkungstests gemacht werden. Die Forscher von Infineon und dem Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München haben nach eigenen Angaben zweieinhalb Jahre an der neuen Zell-Halbleiter-Schnittstelle gearbeitet; an den Grundlagen wird bereits seit rund zehn Jahren geforscht.
Quelle: Taunus Zeitung vom 01.04.2003
end #post-##
Stammzellentherapie macht Leukämiepatienten Hoffnung
end .entry-meta
Eine neue Therapie lässt die Überlebenschancen von Leukämiepatienten erheblich steigen. Experten des Klinikums an der Technischen Universität Dresden haben mit hoch gereinigten, Blut bildenden Stammzellen nach eigenen Angaben bereits zwölf erwachsene Leukämiepatienten geheilt, für die sich keine Spenderzellen gefunden hatten. Wie Martin Bornhäuser und Gerhard Ehninger berichteten, kann das neue Verfahren schon bald zur klinischen Routine gehören.
Kern der Methode ist den Angaben zufolge die Trennung der für den Patienten gefährlichen Immunzellen von den Blut bildenden Stammzellen des Spenders. Würden auch die Immunzellen übertragen, käme es zu schwersten Abwehrreaktionen des Körpers, die häufig tödlich verliefen, sagte Ehninger.
Zur Trennung bedienten sich die Mediziner eines Tricks: Sie setzten Antikörper auf die gespendeten Stammzellen an, die mit kleinsten magnetischen Partikeln versehen sind. Zumeist hefteten sich gleich mehrere dieser für Menschen harmlosen Antikörper an eine einzelne Stammzelle, während die Immunzellen unbehelligt blieben. Wurden danach die in Plasma aufbereiteten Zellen an einem Magneten vorbei gleitet, sammelten sich dort die Stammzellen, während die Immunzellen weiter flossen. Danach schalteten die Ärzte den Magneten aus und leiteten die Stammzellen in ein gesondertes Gefäß.
Wie Ehninger erläuterte, wird das magnetische Trennverfahren zwar seit Jahren für medizinische Analysen von geringen Mengen genutzt; im Klinikum Dresden stehe aber jetzt ein Gerät, das die für die Transplantation benötigten 400 bis 800 Millionen Stammzellen bewältigen könne. Die Stammzellen würden heute auch nicht mehr aus dem Knochenmark entnommen, sondern aus dem Blut. Der Spender erhalte fünf Tage vorher ein Wachstumshormon, das die Produktion dieser Zellen anrege. Sein gesamtes Blut werde dann in einem speziellen Verfahren „gewaschen“. Dabei würden in drei bis vier Stunden die Stammzellen gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt hafteten daran aber noch die für Leukämiepatienten gefährlichen Immunzellen, die im Nachgang durch das neue Trennverfahren abgesondert würden, erklärte der Experte. Obwohl sich die Stammzellen durch das neue Verfahren zuverlässig trennen ließen, bedeute das nicht, dass nun jeder Mensch als Spender in Frage komme. Es müssten immer die nächsten Verwandten sein, also Eltern oder Kinder, sagte Ehninger.
Quelle: Taunus Zeitung vom 02.05.2003
end #post-##
Weniger Gene: Menschliches Genom «komplettiert»
end .entry-meta
London/Jena (dpa) Der Mensch besitzt 20 000 bis 25 000 Gene und damit deutlich weniger als die bisher angenommen 30 000 bis 40 000 Erbanlagen. Dies geht aus der nun weitgehend kompletten Version des menschlichen Erbguts hervor, die das internationale Humangenomprojekt (IHGSC) an diesem Donnerstag im britischen Fachjournal «Nature» (Bd. 431, S. 931) vorstellt.
Die Zahl der chemischen Bausteine des Erbmoleküls DNA beziffert das Konsortium nun auf 3,08 Milliarden. Davon seien inzwischen 2,88 Milliarden (rund 93,5 Prozent) mit bislang unerreichter Genauigkeit in den frei zugänglichen Datenbanken des öffentlich finanzierten Genomprojektes gespeichert.
Genetiker haben das menschliche Genom bereits mehrfach als «entziffert» bezeichnet. Besonders groß war die Aufmerksamkeit im Februar 2001, als sowohl das IHGSC als auch die privat finanzierte Konkurrenz, das US-Biotechnikunternehmen Celera, nach einem Wettrennen um die Sequenzdaten ihre «Arbeitsversionen» präsentierten. Diese enthielten jedoch noch viele Lücken und Ungenauigkeiten. Nur die steuerfinanzierten Genforscher haben ihre Resultate in den vergangenen rund dreieinhalb Jahren mit großem Aufwand komplettiert.
Die an Genen reichen und damit für fast alle Lebensprozesse besonders wichtigen Regionen sind den neuen Angaben zu Folge zu 99 Prozent komplett. Im Durchschnitt komme dabei auf 100 000 richtig gelesene Bausteine nur ein falscher.
«Der Schritt von der Rohfassung zur komplettierten Sequenz hat sich ausgezahlt», sagte Matthias Platzer, Leiter der Genomanalyse am Institut für Molekulare Biotechnologie in Jena. Er ist zugleich Koordinator für genomische Sequenzanalyse innerhalb des deutschen Humangenomprojektes. 58 Prozent der vor drei Jahren vorgestellten Gene hätten Fehler enthalten. Zudem sei nun klar, welches Gen auf welchem Chromosom liege. Im Jahr 2001 habe es zudem noch rund 150 000 Lücken im Genom gegeben. Diese Zahl ist nach den neuen Angaben auf 341 geschrumpft.
«33 von ihnen lassen sich mit den vorhandenen Methoden nicht lesen», sagte Platzer. Die übrigen 308 würden vermutlich zum Gegenstand gesonderter Forschungsprojekte. Ob es je eine «endgültige» Version der menschlichen Erbgutsequenz geben wird, ist fraglich, zumal sich auch die Genome von zwei Menschen um bis zu 0,1 Prozent voneinander unterscheiden.
Quelle: Taunus Zeitung vom 21.10.2004
end #post-##
end .entry-meta
Eine neue Technologie erregt Aufsehen: Sie bringt gezielt Krankheitsgene zum Schweigen. Erste Tests am Menschen laufen bereits
Am liebsten wäre Andrew Fire wohl unsichtbar. Dann könnte er unbemerkt in seinem kargen Büro an der Stanford University in Kalifornien werkeln und in Ruhe mit diesem winzigen Wurm arbeiten, der ihn fast sein ganzes Forscherleben beschäftigt hat. Auf Konferenzen ist der 45-jährige Genetiker selten zu sehen, und fragt man ihn, ob ein Fotograf vorbeikommen dürfe, sagt er nur: „Ach nein, aber ich kann Ihnen das Bild eines Fadenwurms schicken.“ Darunter könne man dann schreiben: Andy Fire. Wer sich lange mit einer Sache beschäftige, schiebt er hinterher, gleiche dieser schließlich irgendwann.
Nun sind Fadenwürmer jedoch äußerst unscheinbare Wesen. Und das ist Fire spätestens seit 1998 nicht mehr. Damals entdeckte er eine Technik, die Krankheitsgene zum Schweigen bringen kann — und weckte die Hoffnung auf neue Waffen gegen Bluthochdruck, Aids oder sogar Krebs.
„Der Fund ist revolutionär“, meint Phillip Sharp, Nobelpreisträger und Genetiker am Massachusetts Institute of Technology bei Boston. Viele Leiden hätten ihre Ursache in einer Fehlsteuerung des Erbguts. „Endlich können wir die beteiligten Gene stilllegen.“ So glatt lief der Fortschritt, dass von der Entdeckung des Phänomens bis zu ersten Versuchen am Menschen nur sechs Jahre vergingen — die Regel ist eher das Doppelte.
Andrew Fire hätte sich diese Entwicklung nicht träumen lassen, als er zusammen mit Craig Mello von der University of Massachusetts an einem fast durchsichtigen Würmchen mit dem wissenschaftlichen Namen Caenorhabditis elegans arbeitete. Die Forscher suchten nach Wegen, dessen Erbgut zu manipulieren. Sie wussten, dass der Zellkern den Stoffwechsel eines Lebewesens über molekulare Boten regelt. Mit ihrer Hilfe stellt die Zelle Hormone oder Enzyme her. Fires und Mellos Idee war deshalb, diesen Übermittler abzufangen, damit der Befehl nicht ans Ziel kommt. Das Gen wäre mundtot gemacht, seine Information wirkungslos. Die Theorie war gut.
Die Praxis war noch besser. Die beiden Tüftler entdeckten, dass der Fadenwurm selbst die Waffen zu haben schien, den molekularen Boten abzufangen. Mit ihnen reguliert er vermutlich seine Gene und bekämpft das Erbgut von Viren. Fire und Mello mussten diesen natürlichen Mechanismus nur noch aktivieren. Das gelang ihnen mit doppelsträngigen RNA-Molekülen, die genau auf das Gen zugeschnitten waren, das sie ausschalten sollten. Die RNA-Interferenz war entdeckt. „Würden die beiden den Nobelpreis bekommen, hätten sie ihn verdient“, kommentiert Sharp.
Niemand wusste zu dieser Zeit jedoch, wie der Mechanismus genau funktioniert — und erst recht nicht, ob es ihn auch beim Menschen gibt. Stefan Limmer und Roland Kreutzer reagierten trotzdem. Ein knappes Jahr nach Fires Entdeckung ließen die beiden Forscher sich eine Idee patentieren: Sie wollten mit kurzen RNA-Stücken Krankheitsgene zensieren. Im Sommer des Folgejahrs gründeten sie die Firma Ribopharma. In einer Baracke auf dem Gelände der Universität Bayreuth begannen sie mit zwei Mitarbeitern und 500000 Euro. „Wir haben einfach ins Blaue hinein geforscht“, erinnert sich Kreutzer. Getroffen aber haben sie ins Schwarze. 2001 zeigte der deutsche Molekularbiologe Thomas Tuschl, inzwischen an der Rockefeller University in New York, dass RNA-Stücke aus 21 bis 23 Bausteinen tatsächlich Gene im Menschen stilllegen. Der Zensor fürs menschliche Erbgut war gefunden.
„Seitdem boomt die Forschung“, sagt Fire, Begründer der RNA-Interferenz. Das Wissenschaftsmagazin „Science“ kürte die Entdeckung 2002 zum „Durchbruch des Jahres“. Konzerne wie Novartis und Bayer stiegen ein und nutzen die Technologie bei ihrer Suche nach neuen Angriffspunkten für Medikamente. Überall sprossen Firmen empor, die Erbgut-Zensoren herstellen und an Forschungseinrichtungen liefern.
Nichts aber verdeutlicht den Boom wohl so gut wie die Geschichte der kleinen Baracke in Bayreuth. Die US-Biotech-Firma Alnylam interessierte sich für ihr Patent und stieg beim Tandem Kreutzer/Limmer ein, fortan hieß deren Firma Alnylam Europe. Schließlich zeigte auch der Pharmagigant Merck Interesse. Mit 40 Millionen Dollar beteiligt er sich nun an der Forschung des Unternehmens. Den Wissenschaftlern war es da in Bayreuth längst zu eng geworden. Sie zogen um ins benachbarte Kulmbach, mitten hinein in die biotechnische Provinz. Wie ein Querschläger aus der Zukunft muss ihre Firma dort zwischen die Fachwerkgemäuer gefahren sein. „Obwohl, Erfahrung mit Biotechnologie haben sie hier ja“, meint Stefan Limmer schmunzelnd. „Die Stadt ist schließlich bekannt für ihre Braukunst.“
Alnylam Europe jedenfalls gedieh, der Mitarbeiterstamm wuchs auf 38. Erste klinische Studien sind für Ende des Jahres geplant. Das Unternehmen will eine häufige Form der Altersblindheit behandeln, die so genannte feuchte Makula-Degeneration. Bei den Betroffenen wuchern Blutgefäße unter die Netzhaut ein, die Sehschärfe nimmt dramatisch ab.
Ob Gen-Zensoren gegen diese Krankheit helfen können, dürfte sich allerdings schon früher zeigen. Seit November 2004 testen zwei US-Biotech-Firmen den Wirkstoff am Menschen. „Spätestens im Sommer wissen wir, wie sicher sie ist“, verspricht Sam Reich, Forschungsleiter von Acuity Pharmaceuticals, einer der beiden Firmen.
Ein erstes Mittel könnte in fünf Jahren zu kaufen sein. Mit vollmundigen Versprechungen halten sich die Forscher aber lieber zurück. Zu tief war der Fall, als die Gentechnologie ihre Heilsversprechen aus den neunziger Jahren nicht erfüllten konnte. „Wir wissen noch nicht, wie gut die neue Methode beim Menschen wirkt“, betont Nobelpreisträger Sharp. Die klinischen Studien von Acuity und Sirna sind dafür noch nicht weit genug. Auch Nebenwirkungen können sie bisher nicht abschätzen. Denn wer Gene im Auge abschaltet, könnte das beispielsweise auch in Bauchspeicheldrüse oder Niere tun. Was aber in einem Organ erwünscht ist, kann an anderer Stelle gravierende Folgen haben.
Noch entscheidender aber ist: Niemand weiß bisher, wie der Wirkstoff in die kranken Zellen gelangen soll. Denn diese nehmen RNA nur sehr zögerlich auf. Wissenschaftler müssen die Moleküle deshalb förmlich hineinpressen. Um beispielsweise Mäuse vor einem Leberversagen bei einer Hepatitis-Infektion zu schützen, spritzte Stefan Kubicka von der Medizinischen Hochschule Hannover die Substanz gleich milliliterweise in ihr Blut. „Auf den Menschen hochgerechnet, entspräche die Dosis fünf Litern, verabreicht innerhalb von fünf Sekunden“, erklärt Kubicka. Die Mäuse überlebten zwar die Tortur, aber einem Menschen möchte sie niemand zumuten. Bei der Altersblindheit wollen die Mediziner diese Hürde nehmen, indem sie den Wirkstoff direkt ins betroffene Organ spritzen. Das aber ist nur bei wenigen Leiden praktikabel.
Eine bessere Methode meint Klaus Strebhardt zu haben. Der Biochemiker sitzt im Erdgeschoss der Frankfurter Universitäts-Frauenklinik, sein Reich ist durch eine Glasfront vom übrigen Klinikbetrieb abgetrennt. An der Tür warnt ein Schild: „Achtung, gentechnische Anlage“. Strebhardt begnügt sich trotzdem mit Krawatte und Jackett. In seinem kleinen Büro erzählt er, wie er Mäusen menschliche Krebszellen einsetzte und anschließend versuchte, den Tumor mit Gen-Zensoren zu bekämpfen. Vergangenen Sommer hatte er Erfolg — mit einem Bruchteil der sonst nötigen Dosis. Strebhardts Trick: Er hatte die kranken Zellen den Wirkstoff selbst herstellen lassen. Dazu bastelte er ein ringförmiges DNA-Molekül, das die dafür nötigen Gene enthielt. Dieses spritzte er dann ins Blut seiner Mäuse. Der Erbgutring gelangte in die entarteten Zellen, stellte dort über mehrere Tage hinweg die gewünschten Zensoren her und schaltete so ein Krebsgen aus: Der Tumor schrumpfte um 80 Prozent. „Als Therapie ist dieser Ansatz viel besser geeignet“, meint auch William Pardridge von der University of California in Los Angeles. Er schaffte es kürzlich, mit einem derartigen Erbgutring Hirntumore zu bekämpfen. Die behandelten Mäuse lebten doppelt so lang wie die unbehandelten.
Die US-Firma Benitec will eine derartige Methode demnächst sogar am Menschen testen. Bis Ende des Jahres erhofft sie sich grünes Licht von der US-Zulassungsbehörde FDA für ihre Aids-Studien. Sie möchte mit Gen-Zensoren das Erbgut des HI-Virus mundtot machen. „So können wir seine Ausbreitung im Körper verhindern“, hofft John Rossi, Molekularbiologe am US-Forschungszentrum City of Hope, der die Methode mit entwickelt hat. Genetiker Sharp sieht das kritisch: „Die eingeschleusten Gene könnten sich ans Erbgut anlagern“, meint er. „Und welche Folgen das für den Organismus hat, ist noch völlig unklar.“ Experten rechnen mit heftigen Nebenwirkungen bis hin zu Krebs.
Zu groß ist dieses Risiko vielen Forschern. Und vielleicht brauchte es die Ruhe von Kulmbach und die Gemütlichkeit eines stämmigen Wissenschaftlers, um eine Alternative aufzutun. Alnylam-Forschungsvize Hans-Peter Vornlocher jedenfalls fand sie. Sein Team hängte kürzlich ein Cholesterol-Molekül an die RNA. Wie ein Schlüssel öffnete es die Zelle, der Weg für das Medikament war frei. Nobelpreisträger Sharp hält das Ergebnis für „einen entscheidenden Schritt vorwärts“. Er schränkt aber ein: Die endgültige Antwort ist es nicht.
Alnylam musste den Mäusen immer noch eine Menge spritzen, die bei einem Menschen mehrere Gramm Wirkstoff bedeuten würde. „Viel versackte wohl in Organen, die wir gar nicht ansteuern wollten“, erklärt Vornlocher. Mit Schlüsseln, die nur auf einen Gewebetyp passen, will er das ändern. Findet er sie, steht den Gen-Zensoren wohl nicht nur die Zelle offen, sondern auch die Zukunft.
„Bekämen die Entdecker den Nobelpreis — sie hätten ihn vollkommen verdient“ Phillip Sharp, Nobelpreisträger und Genetiker vom Massachusetts Institute of Technology, Boston
So legen Forscher Gene still
Schon in den Achtzigern wollten Forscher Gene stilllegen. „Antisense“ hieß das Schlagwort — das Gen sollte mit seinem Gegenstück neutralisiert werden. Aber nur ein Mittel wurde bisher zugelassen. Erfolgreicher könnte die RNA-Interferenz sein — sie ist im Gegensatz zu Antisense ein natürlicher Vorgang. Um ihn auszulösen, müssen Mediziner ein doppelsträngiges RNA-Molekül in die Zelle schleusen, das auf das Ziel-Gen zugeschnitten ist.
STÖRUNG DES STOFFWECHSELS
Zugabe von doppelsträngiger RNA
Enzym RISC trennt den Doppelstrang.
Enzym RISC samt Einzelstrang bindet sich an den Boten, der die genetische Information aus dem Zellkern übermittelt (mRNA).
Zerstückelung der molekularen Boten durch Enzym RISC
Zellen können lebenswichtige Eiweiße nicht mehr herstellen und sterben ab.
NORMALE STOFFWECHSELREGULATION
Molekulare Boten (mRNA) übermitteln die genetische Information aus dem Zellkern.
Enzyme (Ribosomen) entschlüsseln die Botschaft und stellen das gewünschte Eiweiß her.
Regulation des Stoffwechsels Eiweiße dienen als Hormone, Enzyme oder Wachstumsfaktoren.
Zellen wachsen und vermehren sich. Quelle : Focus Ausgabe Nr. 8 2005 Artikel „Zensur im Erbgut“ Autor Robert Thielicke
end #post-##
Schizophrenie: Anzeichen in der Leber entdeckt
end .entry-meta
Anzeichen für die psychische Krankheit Schizophrenie sind nicht nur im Gehirn, sondern auch in anderen Geweben zu finden. Zu diesem Schluss kommen Forscher aus Großbritannien und Deutschland, die in der Leber und den roten Blutkörperchen schizophrener Patienten veränderte Eiweiße entdeckten, wie sie auch im Gehirn von Schizophrenen vorkommen. Die neuen Erkenntnisse könnten die Diagnose der Krankheit verbessern, schreiben Forscher um Sabine Bahn von der Cambridge-Universität in der Fachzeitschrift „Journal of Proteome Research“.
In einer früheren Arbeit hatte das Team um Bahn im Gehirn von verstorbenen Schizophreniepatienten abnormale Eiweiße entdeckt. Nun fanden die Wissenschaftler ähnlich veränderte Proteine auch außerhalb des Gehirns: 14 solcher Eiweiße entdeckten sie in der Leber und 8 in den roten Blutkörperchen. Einige scheinen laut Bahn den Energiestoffwechsel in den Zellen zum Erliegen zu bringen und die Entstehung gefährlicher Sauerstoffverbindungen zu fördern. Die Forscherin vermutet daher, dass Schizophrenie zumindest zum Teil durch diese zwei Prozesse verursacht wird. Tatsächlich hatte sie denn auch in früheren Studien Hinweise darauf gefunden, dass Gehirne von Schizophrenen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung oder dem Verbrauch von Energie haben und anfälliger auf schädliche Sauerstoffverbindungen sind als Gehirne gesunder Menschen.
Die neuen Ergebnisse lassen laut Bahn vermuten, dass es auch in anderen Geweben zu einem Energiemangel und vermehrten Zellschädigungen durch freie Sauerstoffradikale kommen könnte.
Zusätzlich zur Schizophrenie könnten diese Prozesse auch zur Entstehung anderer chronischer Krankheiten führen, erklärt die Wissenschaftlerin. Sie hofft, dass künftig mithilfe der veränderten Proteine das Fortschreiten der Krankheit im Körper verfolgt werden kann. „Wenn Veränderungen außerhalb des Gehirns beobachtet werden können, und wenn diese Veränderungen widerspiegeln, was im Gehirn abläuft, können wir mithilfe dieser Erkenntnisse mehr über die Fehlfunktionen der Zellen lernen, welche die Schizophrenie verursachen“, sagt Bahn. Dadurch könnten sowohl neue Medikamente als auch neue Diagnosemethoden entwickelt werden.
Rund ein Prozent der Weltbevölkerung leidet an Schizophrenie. Bei dieser Krankheit kann es zu Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Denkstörungen kommen. Da das Gehirn betroffen ist, ist die Erforschung der Schizophrenie sehr schwierig. Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt, und es gibt noch keinen vollständig entwickelten Diagnosetest. Bereits bekannt ist, dass Schizophreniepatienten ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten wie beispielsweise Diabetes vom Typ 2 haben. Nach Angaben Bahns gibt es Hinweise darauf, dass diese Gesundheitsprobleme mit der Schizophrenie verknüpft sind. Die neuen Erkenntnisse könnten diesen Zusammenhang nun zu erklären helfen.
Quelle: Taunus-Zeitung 12.01.2007
Mr